12. Evidenzstellentreffen der Verwaltungsgerichte 2025
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz
Das diesjährige Treffen fand beim Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (OÖ) statt und wurde von Präsident Hon.-Prof. Dr. Johannes Fischer eröffnet. Im Mittelpunkt standen die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie die rechtlichen und praktischen Herausforderungen.
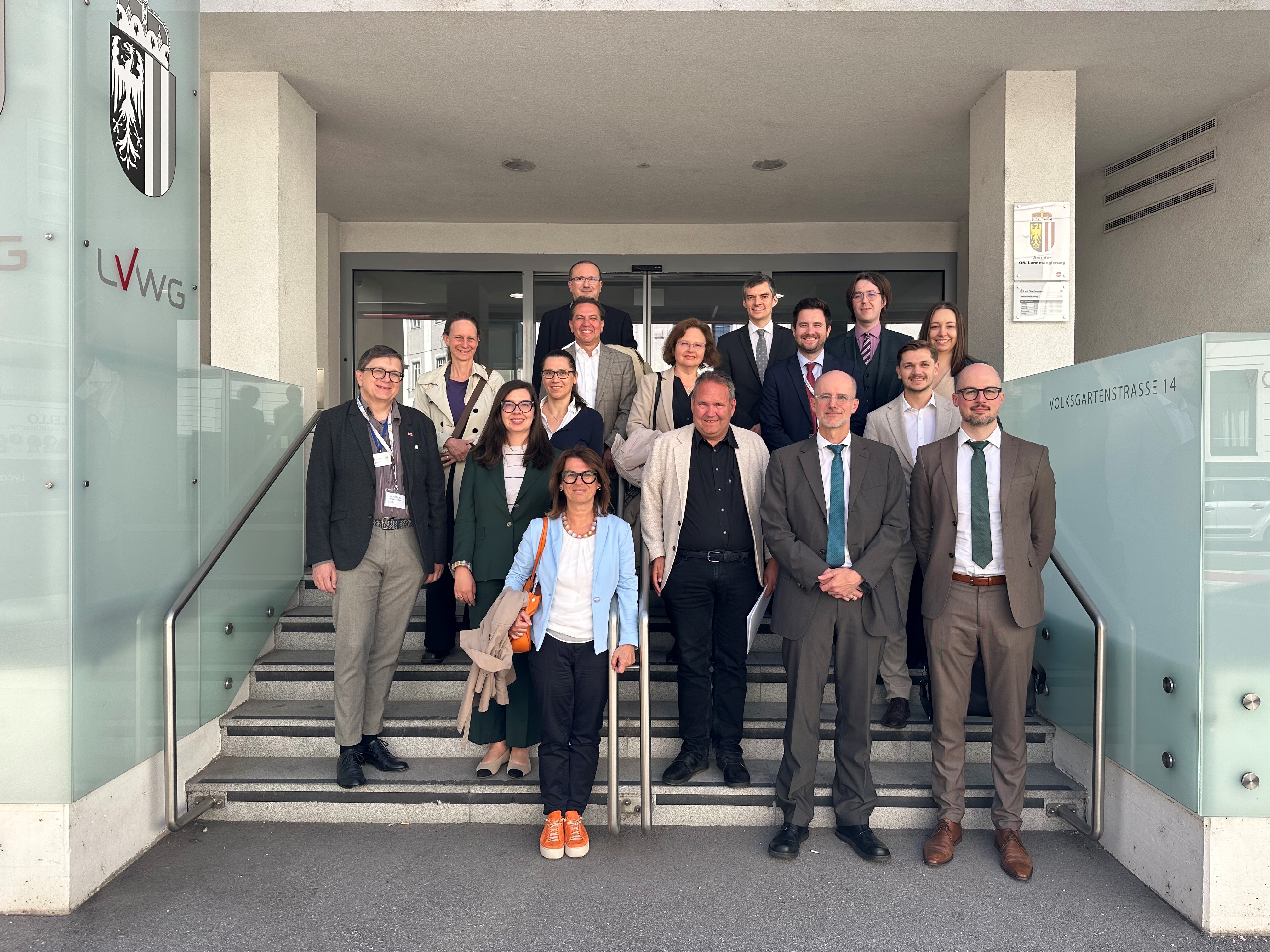
Bereits bei der Begrüßung stellte Präsident Hon.-Prof. Dr. Johannes Fischer fest, dass das Tagungsprogramm den aktuellen Trends entspricht, denn auch die JKU und die FH Hagenberg befassen sich verstärkt mit KI-Projekten für die Gerichte und die Rechtsprechung. HR Dr. Clemens Mayr, der Leiter des VwGH-Evidenzbüros, berichtete zur Rechtssatzbildung, Beobachtung der Rechtsprechung und Anmerkungen im RIS zu Entscheidungsbesprechungen aus der Fachliteratur. Wichtig sei, dass die Verwaltungsgerichte bei ihren Dokumentationen, Revisionsverfahren bzw. aufgehobene Entscheidungen kennzeichnen. Wenn KI genutzt wird, sollte es dafür einen Leitfaden oder dienstliche Anweisungen geben.
Mag.a Ricarda Aschauer vom LIT LAW LAB der JKU und wissenschaftliche Mitarbeiterin am VfGH referierte zu Digitale Verwaltung ante portas. Sie gab einen Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen digitaler Assistenzsysteme und erläuterte die Risiken und Vorgaben beim Einsatz von LLMs (z.B. die Transkription oder Übersetzung von mündlichen Verhandlungen). Wichtige Prinzipien dabei sind: Transparenz, Unmittelbarkeit, Unparteilichkeit sowie Vermeidung von "Automation Bias". Denn KI-Systeme suggerieren Vertrauen, Muster können jedoch diskriminierend sein. Auch wenn KI unterstützen kann, bleibt die richterliche Entscheidungsgewalt menschlich. Gemäß der KI-Verordnung werden Tools für (reine) Verwaltungstätigkeiten nicht als „hochriskant“ eingestuft.
Positive Erfahrungen kamen vom LVwG OÖ zum erfolgreich eingesetzten KI-Anonymisierungstool von BALO.AI. Es ist sehr einfach und bedienerfreundlich. Das Tool wurde an die Bedürfnisse des Gerichtes angepasst und ist sehr zuverlässig. Die Entscheidungsdokumentation ist dadurch einheitlicher und auch kostengünstiger. Auch die Gerichte Salzburg und Steiermark beginnen damit zu arbeiten.
Am Nachmittag stellten Lexis und Manz ihre neuen Suchtechnologien vor: Lexis+ AI, MANZ Genjus KI. Das Motto lautet Chatten statt Suchen und bedeutet Offene Fragestellungen statt simple Stichwortsuche.
Barbara Ofner von LexisNexis zeigte zunächst die Annehmlichkeiten einer Suche nach Gesetzen in Lexis 360. Denn man bekommt als Ergebnis auch künftige Fassungen, Ausschussberichte und andere Hintergrundinformationen. Außerdem kann man Entscheidungen (von VwGH, OGH, BFG) zusammenfassen lassen. Weitere Entscheidungen aus dem RIS werden folgen. Wichtig bei der Fragestellung, beim sogenannten Prompting, ist, detaillierte Angaben zu machen, um auch eine detaillierte Antwort zu erhalten. Bei der Suche in Lexis + AI hat man immer Zugriff auf den gesamten Datenbestand und nicht nur auf die abonnierten Quellen. Wolfgang Horak präsentierte Manz Genjus KI. Auch bei diesem Tool greift man immer auf den gesamten Manz-Datenbestand zu. Im Unterschied zu Lexis verwendet Manz ein deutsches KI-Tool. Auch Zusammenfassungen von Entscheidungen, Gesetzestexten und Literatur sind möglich. Vergleiche verschiedener Kommentierungen einer bestimmten Norm sind wie bei Lexis auch in der RDB möglich. Sogar eine (simple) semantische Suche zum Auffinden von ähnlichen Textpassagen wird in der RDB unterstützt.
Mit den Quellenangaben kann man das Rechercheergebnis sowohl bei Lexis als auch bei Manz sehr gut nachvollziehen. Strukturierte Dokumente und Metadaten verbessern die Suchergebnisse deutlich. Da die Nutzung dieser Recherche-Tools sowie anderer KI-Tools viele Vorteile bringen, ist bei Gerichten das Einhalten einer Gliederung in Dokumentvorlagen sinnvoll.
Lexis + AI ist es sogar möglich, eigene Texte hochzuladen, um sich Entwürfe (Mails, Verträge, Entscheidungen) erstellen zu lassen. Bei Manz Genjus KI ist dies erst für nächstes Jahr geplant. Manz will vorher datenschutzrechtlich alles geklärt haben.
Fazit und Ausblick auf 2026
Digitale Werkzeuge und Künstliche Intelligenz werden künftig bei Gerichten eine größere Rolle spielen, u.a. bei der Dokumentation, Aktenführung und Entscheidungsfindung.
Im September 2025 tritt das IFG in Kraft. Wenn mehr Entscheidungen veröffentlicht werden sollen, benötigt man nicht nur einfache und verlässliche Anonymisierungstools, sondern ebensolche Abfragetools. Mit KI ist beides möglich. Für Gesprächsstoff beim nächsten Treffen 2026 (voraussichtlich wieder in Wien) ist daher gesorgt.